Als sie vor Pandemien in der Zukunft warnten, wurden sie nicht gehört. Als die Welt von der COVID-19-Pandemie heimgesucht wird, müssen dieselben Wissenschaftler nicht nur gegen das Virus kämpfen, sondern auch gegen eine Welle von Fehlinformationen, Verschwörungstheorien und politischer Schuldzuweisung, die drohen, die Wahrheit zu überlagern. Der Film erzählt ihre Geschichte.
Zu Beginn des Jahres gibt es eine Reihe an Preview-Terminen zum Dokumentarfilm BLAME mit anschließenden Gesprächen. In drei Städten finden die Gespräche in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft statt.
Köln, 3. Februar 2026
Nach der Filmvorführung Gespräch mit dem Regisseur Christian Frei und Dr. Leon Wansleben, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln (Forschungsthema „Umstrittene Ökologien“), moderiert von Carolin Riethmüller, Wissenschaftsjournalistin und Dokumentarfilmerin.
Berlin, 6. Februar 2026
Nach der Filmvorführung Gespräch mit dem Regisseur Christian Frei und Dr. Philipp Lorenz-Spreen, Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin sowie Forschungsgruppenleiter an der TU Dresden (Forschungsthema: Der selbstorganisierte Online-Diskurs und dessen Auswirkungen auf Demokratien weltweit). Moderation: Dr. Dorothee Nolte, Tagesspiegel
München, 7. Februar 2026
Nach der Filmvorführung Gespräch mit dem Regisseur Christian Frei, Prof. John Briggs, Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, Dr. Christina Beck, Leiterin Kommunikation der Max-Planck-Gesellschaft und Dr. Christina Berndt, Leitende Redakteurin Wissen bei der Süddeutschen Zeitung.
Passende MAX-Hefte zu einzelnen Aspekten aus dem Film:
 Biomax 36: Im Wettlauf mit dem Virus
Biomax 36: Im Wettlauf mit dem Virus
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zeigt das Heft Forschungsergebnisse zur Struktur der Spike-Proteine und erklärt das Prinzip der mRNA-Impfstoffe. Zudem wird die Bedeutung der Grundlagenforschung für die rasante Impfstoffentwicklung thematisiert.
 Geomax 31: Demokratie und Social Media
Geomax 31: Demokratie und Social Media
Soziale Medien bieten nicht nur Unterhaltung, sondern prägen auch den politischen Diskurs und gesellschaftliche Debatten. Das Geomax-Heft zeigt, wie sich die öffentliche Kommunikation verändert hat und welche Rolle dabei soziale Medien spielen. Max-Planck-Forscherinnen erklären Vorteile und Gefahren der Plattformen für die Demokratie.
Bild auf der Startseite und Bild oben: ® Blame by C. Frei
Die Vortragsreihe zu den MAX-Heften richtet sich an Lehrkräfte, Jugend forscht-Projektbetreuende und vertieft interessierte Schülerinnen und Schüler.
20.1.2026 von 15.30 bis 16.45 Uhr
Kunststoffe im Kreislauf – vom Abfall zur Ressource
Dr. Manuel Häußler, Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung
Bei der Entwicklung der Kunststoffe vor rund 70 Jahren wurde im molekularen Design das Recycling zu wenig mitgedacht. So wachsen Bedarf, Produktion und auch der Plastikmüll. Manuel Häußler erforscht und entwickelt neue Polymere, die vollständig recycelbar sind und gleichzeitig die positiven Materialeigenschaften bestehender Kunststoffe besitzen. In seinem Vortrag erklärt er die Herstellung und das Recyclingprinzip eines kreislauffähigen Polyesters, der Polyethylen ersetzen könnte und zeigt Wege zu einer nachhaltigen Kunststoffproduktion auf.
Anmeldeschluss: 19.1.2026
Anmeldung geschlossen
Zum passenden MAX-Heft
 Im Rahmen des Internationalen Jahres der Quantenwissenschaft und -technologie stehen Schulen verschiedene Materialien und Medien aus der Forschung der Max-Planck-Institute zur Verfügung.
Im Rahmen des Internationalen Jahres der Quantenwissenschaft und -technologie stehen Schulen verschiedene Materialien und Medien aus der Forschung der Max-Planck-Institute zur Verfügung.
 Techmax 36: Quantencomputer und Quanteninternet
Techmax 36: Quantencomputer und Quanteninternet
Das Heft erläutert die quantenphysikalischen Grundlagen des Forschungsfeldes und geht unter anderem darauf ein, welche Bedeutung die Verschränkung von Quantenteilchen hat und wie sich Quantencomputer von herkömmlichen Rechnern unterscheiden.
 Techmax 37: Quantenkryptographie
Techmax 37: Quantenkryptographie
Das Heft erklärt kryptographische Verfahren zum sicheren Austausch von Geheimschlüsseln mit Hilfe der Quantenphysik. Max-Planck-Teams erforschen Technologien zur Übertragung über Glasfaser und Satelliten, um die Sicherheit der Kommunikation zu verbessern.
 Sonderausgabe: Wissenscomic „Quantenkryptographie“
Sonderausgabe: Wissenscomic „Quantenkryptographie“
Der Wissenscomic erklärt die Quantenkryptographie auf anschauliche Weise. Alice und Bob sind einer Spionin im Quantenkanal auf der Spur, Kater Erwin kommentiert das Experiment zur Quantenverschlüsselung.
 Podcast max-audio: Quantencomputer
Podcast max-audio: Quantencomputer
In der aktuellen Folge geht es um verschränkte Teilchen, Quantenkommunikation und Quantencomputer.
Weitere MAX-Hefte mit quantenphysikalischem Bezug
Techmax 06: Laser
Techmax 33: Echtzeit-MRT
Weitere Infos aus der Max-Planck-Gesellschaft
Themenseite Quantenphysik

© Logos: Quantum2025 und IYQ-Logo
 Max Planck stellte im Jahr 1900 ein neues Strahlungsgesetz vor und führte „Energieelemente“ bestimmter Größe ein, die wir heute als Quanten bezeichnen. Die Formulierung der Quantenmechanik im Jahr 1925 bildete die Grundlage für technische Entwicklungen wie Laser, Transistoren oder die Magnetresonanztomografie. Die Podcast-Folge nimmt uns mit in die Quantenwelt und beleuchtet ihre aktuellen Entwicklungen. Gerhard Rempe vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik spricht mit Wissenschaftsjournalist Stefan Geier über verschränkte Teilchen, Quantenkommunikation und Quantencomputer.
Max Planck stellte im Jahr 1900 ein neues Strahlungsgesetz vor und führte „Energieelemente“ bestimmter Größe ein, die wir heute als Quanten bezeichnen. Die Formulierung der Quantenmechanik im Jahr 1925 bildete die Grundlage für technische Entwicklungen wie Laser, Transistoren oder die Magnetresonanztomografie. Die Podcast-Folge nimmt uns mit in die Quantenwelt und beleuchtet ihre aktuellen Entwicklungen. Gerhard Rempe vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik spricht mit Wissenschaftsjournalist Stefan Geier über verschränkte Teilchen, Quantenkommunikation und Quantencomputer.
Die Vortragsreihe zu den MAX-Heften richtet sich an Lehrkräfte, Jugend forscht-Projektbetreuende und vertieft interessierte Schülerinnen und Schüler.
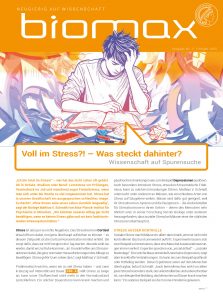 27.11.2025 von 15.30 bis 16.45 Uhr
27.11.2025 von 15.30 bis 16.45 Uhr
Stress – Was passiert dabei in unserem Körper?
PD Dr. Mathias V. Schmidt, Max-Planck-Institut für Psychiatrie
Stress gehört zum Leben – wie der Körper darauf reagiert und wann Stress zum Risikofaktor für Erkrankungen wird, erklärt Mathias Schmidt. Die Stressforschung untersucht auch, welche Rolle genetische Faktoren bei der Stressreaktion spielen und warum Menschen unterschiedlich mit Belastungen umgehen können.
Anmeldeschluss: 26.11.2025
Anmeldung geschlossen
Zum passenden MAX-Heft
 Die Erforschung von Exoplaneten gehört zu den spannendsten Kapiteln der Astronomie. Das neue TECHMAX-Heft erklärt, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler solche Himmelskörper aufspüren und untersuchen. Es beschreibt verschiedene Typen von Exoplaneten und zeigt, wie herausfordernd die Suche nach Lebensspuren auf fernen Welten ist.
Die Erforschung von Exoplaneten gehört zu den spannendsten Kapiteln der Astronomie. Das neue TECHMAX-Heft erklärt, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler solche Himmelskörper aufspüren und untersuchen. Es beschreibt verschiedene Typen von Exoplaneten und zeigt, wie herausfordernd die Suche nach Lebensspuren auf fernen Welten ist.

Physik-Preisträgerinnen und -Preisträger des Wettbewerbs „Jugend forscht“ besuchten das Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts – ein Ort, an dem die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie im Mittelpunkt steht. Es fanden Fachvorträge zur Forschungsthemen des Erlanger Instituts statt und die Gruppe konnte verschiedene Labore besichtigen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beantworteten Fragen zum Studium und zur Promotion und erzählten von ihren persönlichen Wegen in die Forschung.
FÜR DEN PHYSIKUNTERRICHT
Zwei MAX-Hefte greifen Forschungsgebiete des Max-Planck-Instituts auf.

 Techmax 37: Quantenkryptographie
Techmax 37: Quantenkryptographie
Techmax 39: KI in der Wissenschaft
Das MPI für die Physik des Lichts bietet für Schulen in der Region Besuche an.
> Zur Website des Instituts
Kontakt: MPLpresse@mpl.mpg.de
Mitmachen bei > Jugend forscht
Bild auf der Startseite und Gruppenfoto: © MPI für die Physik des Lichts
 Im Tokamak-Experiment ASDEX Upgrade des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Garching wird an Kernfusion geforscht. Der Film zeigt einen Messtag beim Fusionsexperiment und erklärt, warum die Kernfusion als Energiequelle großes Potenzial hat.
Im Tokamak-Experiment ASDEX Upgrade des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Garching wird an Kernfusion geforscht. Der Film zeigt einen Messtag beim Fusionsexperiment und erklärt, warum die Kernfusion als Energiequelle großes Potenzial hat.
> Zum Film
> Zum TECHMAX-Heft „Kernfusion“

© Science Intermedia
Um die Geheimnisse des größten Ökosystems der Erde zu ergründen, befassen sich Forschende des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie mit Bakterien, Viren und anderen Mikroben im Meer. Die Reihe „Abenteuer Tiefsee“ präsentiert das Thema Algenblüte mit einem Comic und einem Kurzfilm.
Jedes Jahr im Frühling ereignet sich ein faszinierendes Naturschauspiel in der Deutschen Bucht. Mikroalgen vermehren sich dabei so massenhaft, dass sie wie ein riesiger Organismus wirken. Aber was steckt hinter dem Phänomen der Algenblüte? Und welche Auswirkungen hat sie auf Mensch und Natur? Das Team des Forschungsschiffs Tiefsee geht der Sache auf den Grund…
Print-Exemplare des Comics gibt es in begrenzter Anzahl auf Nachfrage bei Dr. Fanni Aspetsberger: Kontakt: presse@mpi-bremen.de