Als sie vor Pandemien in der Zukunft warnten, wurden sie nicht gehört. Als die Welt von der COVID-19-Pandemie heimgesucht wird, müssen dieselben Wissenschaftler nicht nur gegen das Virus kämpfen, sondern auch gegen eine Welle von Fehlinformationen, Verschwörungstheorien und politischer Schuldzuweisung, die drohen, die Wahrheit zu überlagern. Der Film erzählt ihre Geschichte.
Zu Beginn des Jahres gibt es eine Reihe an Preview-Terminen zum Dokumentarfilm BLAME mit anschließenden Gesprächen. In drei Städten finden die Gespräche in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft statt.
Köln, 3. Februar 2026
Nach der Filmvorführung Gespräch mit dem Regisseur Christian Frei und Dr. Leon Wansleben, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln (Forschungsthema „Umstrittene Ökologien“), moderiert von Carolin Riethmüller, Wissenschaftsjournalistin und Dokumentarfilmerin.
Berlin, 6. Februar 2026
Nach der Filmvorführung Gespräch mit dem Regisseur Christian Frei und Dr. Philipp Lorenz-Spreen, Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin sowie Forschungsgruppenleiter an der TU Dresden (Forschungsthema: Der selbstorganisierte Online-Diskurs und dessen Auswirkungen auf Demokratien weltweit). Moderation: Dr. Dorothee Nolte, Tagesspiegel
München, 7. Februar 2026
Nach der Filmvorführung Gespräch mit dem Regisseur Christian Frei, Prof. John Briggs, Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, Dr. Christina Beck, Leiterin Kommunikation der Max-Planck-Gesellschaft und Dr. Christina Berndt, Leitende Redakteurin Wissen bei der Süddeutschen Zeitung.
Passende MAX-Hefte zu einzelnen Aspekten aus dem Film:
 Biomax 36: Im Wettlauf mit dem Virus
Biomax 36: Im Wettlauf mit dem Virus
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zeigt das Heft Forschungsergebnisse zur Struktur der Spike-Proteine und erklärt das Prinzip der mRNA-Impfstoffe. Zudem wird die Bedeutung der Grundlagenforschung für die rasante Impfstoffentwicklung thematisiert.
 Geomax 31: Demokratie und Social Media
Geomax 31: Demokratie und Social Media
Soziale Medien bieten nicht nur Unterhaltung, sondern prägen auch den politischen Diskurs und gesellschaftliche Debatten. Das Geomax-Heft zeigt, wie sich die öffentliche Kommunikation verändert hat und welche Rolle dabei soziale Medien spielen. Max-Planck-Forscherinnen erklären Vorteile und Gefahren der Plattformen für die Demokratie.
Bild auf der Startseite und Bild oben: ® Blame by C. Frei
Die Vortragsreihe zu den MAX-Heften richtet sich an Lehrkräfte, Jugend forscht-Projektbetreuende und vertieft interessierte Schülerinnen und Schüler.
20.1.2026 von 15.30 bis 16.45 Uhr
Kunststoffe im Kreislauf – vom Abfall zur Ressource
Dr. Manuel Häußler, Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung
Bei der Entwicklung der Kunststoffe vor rund 70 Jahren wurde im molekularen Design das Recycling zu wenig mitgedacht. So wachsen Bedarf, Produktion und auch der Plastikmüll. Manuel Häußler erforscht und entwickelt neue Polymere, die vollständig recycelbar sind und gleichzeitig die positiven Materialeigenschaften bestehender Kunststoffe besitzen. In seinem Vortrag erklärt er die Herstellung und das Recyclingprinzip eines kreislauffähigen Polyesters, der Polyethylen ersetzen könnte und zeigt Wege zu einer nachhaltigen Kunststoffproduktion auf.
Anmeldeschluss: 19.1.2026
Anmeldung geschlossen
Zum passenden MAX-Heft
 Im Tokamak-Experiment ASDEX Upgrade des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Garching wird an Kernfusion geforscht. Der Film zeigt einen Messtag beim Fusionsexperiment und erklärt, warum die Kernfusion als Energiequelle großes Potenzial hat.
Im Tokamak-Experiment ASDEX Upgrade des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Garching wird an Kernfusion geforscht. Der Film zeigt einen Messtag beim Fusionsexperiment und erklärt, warum die Kernfusion als Energiequelle großes Potenzial hat.
> Zum Film
> Zum TECHMAX-Heft „Kernfusion“
Wir erweitern sukzessive die Aufgabensammlung zu den MAX-Heften! Die Aufgaben adressieren Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II und beziehen sich auf konkrete Inhalte der MAX-Hefte. Sie werden von Lehrkräften entwickelt und enthalten alle nötigen Materialien und Lösungen. Die Aufgaben sind beim jeweiligen MAX-Heft in der rechten Randspalte unter dem Punkt „Unterrichtsmaterial“ verlinkt. Außerdem sind sie im Bereich „max-media“ zu finden.
Derzeit liegen zu folgenden MAX-Heften (neue) Aufgaben vor:
TECHMAX 04: Gravitationswellen
TECHMAX 06: Laser
TECHMAX 10: Katalyse, Ammoniak als Wasserstoffspeicher
TECHMAX 12: Elementarteilchen
TECHMAX 13: Leistungsfähigere Akkumulatoren
TECHMAX 16: Brennstoffzellen
TECHMAX 19: Korrosion
TECHMAX 28: Nanotechnologie, Nanocellulose
TECHMAX 29: Polymere und Nanokapseln
TECHMAX 30: Organische Katalyse
TECHMAX 32: Luftschadstoff Stickstoffdioxid
TECHMAX 33: Echtzeit-MRT
TECHMAX 35: Methanolsynthese aus Abgasen
neu TECHMAX 38: Kunststoffe im Kreislauf
BIOMAX 10: Stammzellen
BIOMAX 14: Artenvielfalt
BIOMAX 15: Ionenkanäle
BIOMAX 22: Synapse
BIOMAX 23: Epigenetik
BIOMAX 34: Endosymbiontentheorie
BIOMAX 31: Immunsystem
BIOMAX 32: Stadtvögel
BIOMAX 35: CRISPR-Cas9
BIOMAX 36: mRNA-Impfstoffe
BIOMAX 37: Künstliche Fotosynthese
BIOMAX 38: Wie die Spitzmaus Energie spart
GEOMAX 11: Stickstoffkreislauf
GEOMAX 18: Climate Engineering
GEOMAX 20: Migration
GEOMAX 22: Kohlenstoffkreislauf
GEOMAX 24: Waldbrände am Amazonas
GEOMAX 25: Extremwetter
GEOMAX 26: Wirtschaftswachstum
GEOMAX 27: Überfischte Meere
GEOMAX 28: Megastädte an Küsten
GEOMAX 29: Europa auf dem grünen Weg
neu GEOMAX 30: Kohlenstoffsenken
neu GEOMAX 31: Demokratie und Social Media
neu Videointerview: Social Media
Wir starten die neue Vortragsreihe mit dem Thema Quantenkryptographie. Die Vortragsreihe zu den MAX-Heften richtet sich an Lehrkräfte, Jugend forscht-Projektbetreuende und vertieft interessierte Schülerinnen und Schüler.
 25.9.2025 von 15.30 bis 16.45 Uhr
25.9.2025 von 15.30 bis 16.45 Uhr
Quantenkryptographie
Prof. Dr. Christoph Marquardt, Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts
Die Quantenphysik bietet einzigartige Möglichkeiten für die Verschlüsselung von Nachrichten. Doch wie funktioniert der Austausch von Quantenschlüsseln über größere Distanzen? Christoph Marquardt erklärt kryptographische Verfahren und Technologien zur Übertragung von Quantenschlüsseln über Satelliten.
Zur Anmeldung für Lehrkräfte, Jugend forscht-Projektbetreuende sowie volljährige Schülerinnen und Schüler
Zur Anmeldung für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren
Zum passenden MAX-Heft
Foto Startseite: © S. Spangenberg / MPI für die Physik des Lichts
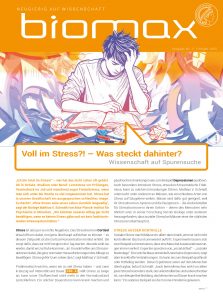 „Ich bin total im Stress!“ – wer hat das nicht schon oft gehört. Lernstress vor Prüfungen, Termindruck im Job, Social Media – manchmal wird es einfach zu viel. Aber was passiert da eigentlich in unserem Körper? Warum fühlen sich manche Menschen gestresster als andere? Und: Wie bleibt man mental gesund? Mathias V. Schmidt vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie spricht mit Wissenschaftsjournalistin Alice Lanzke über Erkenntnisse aus der Stressforschung.
„Ich bin total im Stress!“ – wer hat das nicht schon oft gehört. Lernstress vor Prüfungen, Termindruck im Job, Social Media – manchmal wird es einfach zu viel. Aber was passiert da eigentlich in unserem Körper? Warum fühlen sich manche Menschen gestresster als andere? Und: Wie bleibt man mental gesund? Mathias V. Schmidt vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie spricht mit Wissenschaftsjournalistin Alice Lanzke über Erkenntnisse aus der Stressforschung.
Zur neuen Podcast-Folge | Alle Podcast-Folgen
> Online-Vortrag zur Stressforschung am 27.11.25
Das Zentrum für Kommunikation und Austausch am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell feiert Anfang Oktober sein 15-jähriges Jubiläum mit einem vielfältigen Angebot, das von Ausstellungen und Diskussionsrunden bis hin zu Workshops reicht.
Am 6. und 7. Oktober gibt es Vorträge und Workshops für Schulklassen der Jahrgangsstufen 6-10.
Eine Anmeldung über die MaxCine-Webseite ist bis 26.9.25 möglich.
Details zu den Angeboten und zur Anmeldung finden Sie > hier
Bild auf der Startseite: © MaxCine
 Wenn es um Maßnahmen gegen den Klimawandel geht, stehen häufig technische Lösungen im Vordergrund: Maschinen, die CO₂ aus der Luft filtern, spezielle Baustoffe oder Speicheranlagen. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass die Natur selbst eine starke Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel sein kann. Wälder, Moore und Ozeane nehmen seit Millionen von Jahren Kohlenstoffdioxid auf – und könnten auch jetzt eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Erderwärmung spielen. Sönke Zaehle vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie erklärt, warum diese Kohlenstoffsenken so wichtig sind, wie sie sich verändern und was für ihren Schutz nötig ist.
Wenn es um Maßnahmen gegen den Klimawandel geht, stehen häufig technische Lösungen im Vordergrund: Maschinen, die CO₂ aus der Luft filtern, spezielle Baustoffe oder Speicheranlagen. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass die Natur selbst eine starke Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel sein kann. Wälder, Moore und Ozeane nehmen seit Millionen von Jahren Kohlenstoffdioxid auf – und könnten auch jetzt eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Erderwärmung spielen. Sönke Zaehle vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie erklärt, warum diese Kohlenstoffsenken so wichtig sind, wie sie sich verändern und was für ihren Schutz nötig ist.
Das 60. Bundesfinale des Wettbewerbs Jugend forscht stand dieses Jahr unter dem Motto „Macht aus Fragen Antworten“. 167 junge MINT-Talente präsentierten am vergangenen Wochenende in Hamburg ihre Forschungsprojekte. Vizepräsidentin Prof. Dr. Claudia Felser verlieh den ersten Preis im Fachgebiet Physik an Johanna Freya Pluschke. Die Jungforscherin programmierte eine Software, mit der sich zentrale Prozesse von Ionentriebwerken, die auch Raumfahrzeuge elektrisch antreiben, nachbilden lassen. Unter anderem lässt sich damit simulieren, wie das Gas, das für den Schub sorgt, ionisiert beziehungsweise elektrisch aufgeladen wird. > Zum Forschungsprojekt
Zur Frage, wie mehr junge Talente ihr Potenzial frei entfalten können, sagte Claudia Felser: „Ich wünsche mir, dass der Wettbewerb weiterhin junge Menschen fördert, unabhängig von der Schulform oder dem soziokulturellen Hintergrund.“
Die Max-Planck-Gesellschaft unterstützt seit vielen Jahren den Wettbewerb Jugend forscht und stiftet die Preise im Fachbereich Physik. Der Wettbewerb wurde 1965 vom damaligen stern-Chefredakteur Henri Nannen geründet. Die gesellschaftlich breit angelegte Initiative entwickelte sich schnell zu Deutschlands bekanntestem MINT-Nachwuchswettbewerb.
 Gärten gelten zunehmend als ökologische Nischen für Flora und Fauna, die in der modernen Agrarlandschaft selten geworden sind. „Doch wie vielfältig sie wirklich sind, wissen wir oft gar nicht“, sagt Jana Wäldchen vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie. Das Team des Citizen-Science-Projekts „GartenDiv“ möchte dies ändern und erstmals die Pflanzenvielfalt in Deutschlands Gärten erfassen und kartieren. Dabei soll auch das ökologische Potenzial von Gärten, etwa für den Schutz bedrohter Insektenarten, aufgezeigt werden. Für die Datenerfassung wird die bekannte Flora Incognita-App genutzt, die vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie und der TU Ilmenau entwickelt und für das Projekt angepasst wurde. „Dank der Flora Incognita-App ist es ganz einfach, Pflanzen sicher zu bestimmen“, so Wäldchen. „Bereits Grundschulkinder können damit spielerisch entdecken, wie viele verschiedene Pflanzen im Schulgarten wachsen.“ Mitmachen ist ganz einfach: In der Flora Incognita-App das Projekt „GartenDiv“ freischalten, die Pflanzen im Garten bestimmen und die Beobachtungen mit dem Schlagwort „GartenDiv“ markieren.
Gärten gelten zunehmend als ökologische Nischen für Flora und Fauna, die in der modernen Agrarlandschaft selten geworden sind. „Doch wie vielfältig sie wirklich sind, wissen wir oft gar nicht“, sagt Jana Wäldchen vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie. Das Team des Citizen-Science-Projekts „GartenDiv“ möchte dies ändern und erstmals die Pflanzenvielfalt in Deutschlands Gärten erfassen und kartieren. Dabei soll auch das ökologische Potenzial von Gärten, etwa für den Schutz bedrohter Insektenarten, aufgezeigt werden. Für die Datenerfassung wird die bekannte Flora Incognita-App genutzt, die vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie und der TU Ilmenau entwickelt und für das Projekt angepasst wurde. „Dank der Flora Incognita-App ist es ganz einfach, Pflanzen sicher zu bestimmen“, so Wäldchen. „Bereits Grundschulkinder können damit spielerisch entdecken, wie viele verschiedene Pflanzen im Schulgarten wachsen.“ Mitmachen ist ganz einfach: In der Flora Incognita-App das Projekt „GartenDiv“ freischalten, die Pflanzen im Garten bestimmen und die Beobachtungen mit dem Schlagwort „GartenDiv“ markieren.
Das Projekt „GartenDiv“ wird federführend von der Universität Leipzig durchgeführt. Weitere Partner sind das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, das Julius Kühn-Institut (JKI) Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, der Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands (BKD) e.V. sowie Flora Incognita.
Foto auf der Startseite: © Sonja Birkelbach / Adobe Stock