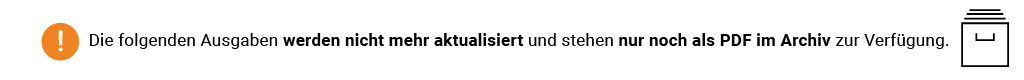
Knapp hundert Jahre nach Entdeckung der ersten phagozytischen Zellen durch Elie Metschnikow 1908 sind Max-Planck-Forscher einem bisher unbekannten Abwehrmechanismus unseres angeborenen Immunsystems auf die Spur gekommen.
› mehrSeit 33 Jahren untersuchen Forscher die Lebensweise und einzigartige Kultur der Taï-Schimpansen. Ihre Erkenntnisse über das Merken von Nahrungsstandorten, die Rivalität zwischen verschiedenen Schimpansen-Clans, gemeinsame Jagdstrategien bis hin zu dem aufregenden Befund, dass es auch bei Schimpansen Adoptionen gibt, führen uns zu den Wurzeln unseres Verhaltens.
› mehrDass Pflanzen eine innere Uhr besitzen, die ihnen erlaubt, die Tageslänge zu messen, wurde lange Zeit mit Skepsis aufgenommen. Erst durch die Isolation der daran beteiligten Gene und Proteine werden schrittweise jene Mechanismen klarer, mit deren Hilfe Pflanzen die Zeit messen und ihren Lebenszyklus steuern.
› mehrViren sind Parasiten, die an der Grenze zwischen belebter und unbelebter Natur existieren. Als Auslöser von Seuchen stellen sie immer wieder eine große Herausforderung dar. Um ihr Überleben zu sichern, haben Viren unterschiedliche Strategien entwickelt.
› mehrBei höchstens zehn Prozent der Vogelarten ist sozial monogames Zusammenleben mit monogamer Paarung bzw. Fortpflanzung gleichzusetzen. Im Licht der Evolution betrachtet, wird deutlich, warum beispielsweise Vögel unterschiedliche Paarungsstrategien wählen: es geht darum den Fortpflanzungserfolg zu maximieren.
› mehrNach jahrzehntelanger Arbeit ist es Forschern gelungen, die Struktur des Ribosoms Atom für Atom zu entschlüsseln - und damit die Grundlagen zu legen für eine gezielte Entwicklung neuer Antibiotika.
› mehrAuf der Suche nach neuen therapeutischen Ansätzen beispielsweise für Krebs suchen Forscher im Genom des kleinen Fadenwurms C. elegans nach neuen Zielmolekülen, vor allem jenen Genen, die Zellteilungsprozesse steuern.
› mehrWozu eigentlich Sex? Aus evolutionsbiologischer Sicht eine berechtigte Frage, denn tatsächlich haben Organismen, die sich asexuell fortpflanzen, einen großen Vorteil: Sie erzeugen doppelt so viele Nachkommen wie sich sexuell fortpflanzende Organismen. Warum also bleibt Sex trotz seiner hohen Kosten in einer Art erhalten?
› mehrAuch mehr als hundert Jahre nach der Entdeckung des Tuberkulose-Erregers durch Robert Koch gibt es noch keinen wirksamen Impfstoff gegen die Tuberkulose. Forscher analysieren daher die Details der Immunantwort nach einer Infektion mit Mycobacterium tuberculosis.
› mehrLange Zeit war umstritten, ob es so etwas wie eine "innere Uhr" überhaupt gibt. Inzwischen sind selbst die molekularen Grundlagen der biologischen Uhr recht gut bekannt. Ein Verständnis für die Mechanismen biologischer Zeitprogramme ist für den Menschen besonders wichtig, da unser technisiertes und elektrifiziertes Leben die natürlichen Zeitstrukturen von Tag und Nacht immer stärker verwischt.
› mehr